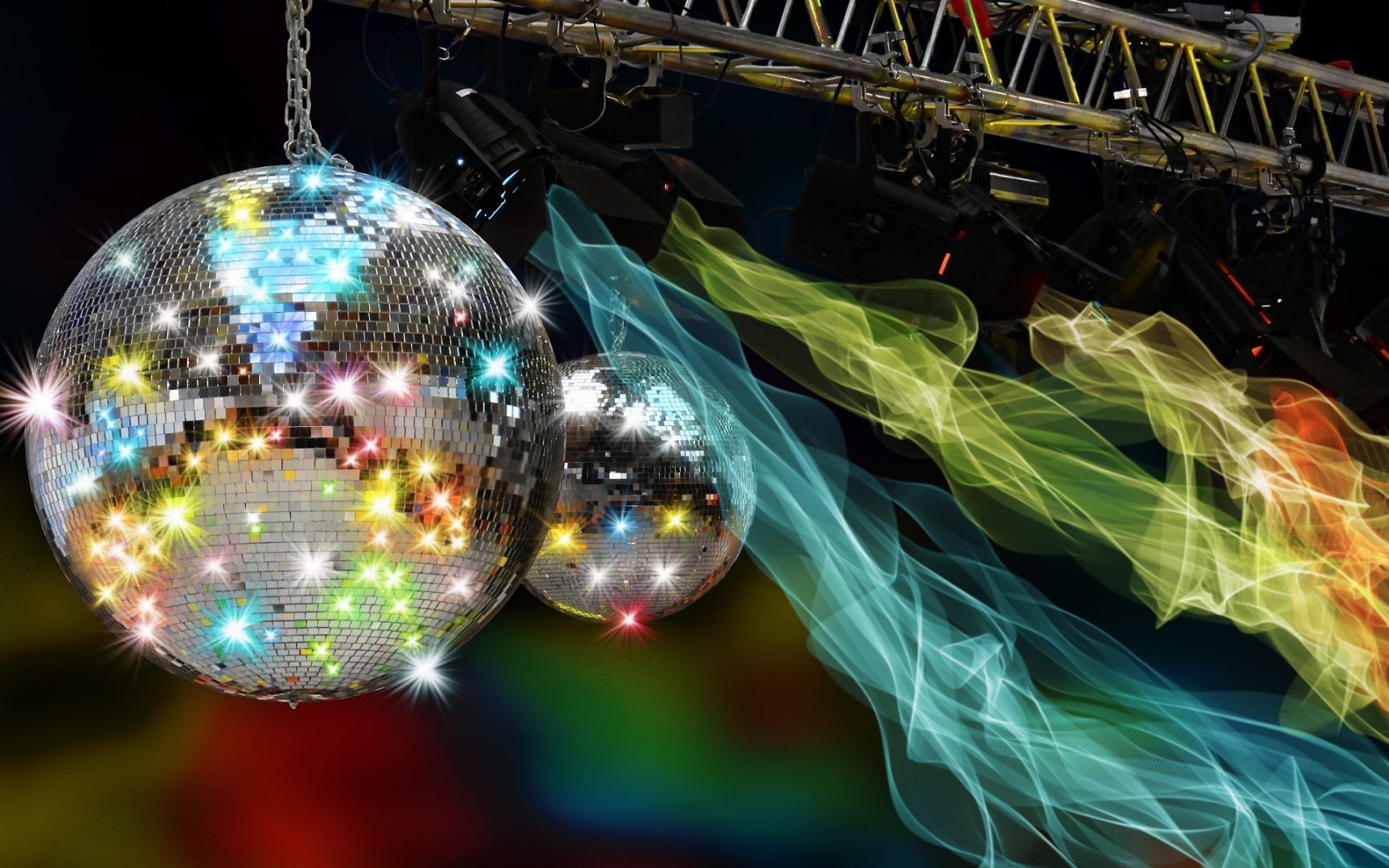Drei Wünsche und ein Kochlöffel
Etwas lag in der Luft – mehr als nur der Duft aufgewärmter Fertiggerichte und der leichte Dampf, der aus der Mikrowelle aufstieg. Es war ein stilles Flirren, kaum wahrnehmbar, doch spürbar für jene, die genau hinsahen. In der kleinen Küche einer noch kleineren WG geschah an diesem Tag etwas, das selbst die ungeduldige Chantal für einen Moment innehalten ließ. Zwischen Klicks auf dem Handy und dem Summen der Mikrowelle bahnte sich etwas an, das nicht in ihren Alltag gehörte. Noch wusste sie nicht, dass dieser Tag anders enden würde, als sie ihn begonnen hatte. Und dass manchmal selbst der banalste Moment der Anfang von etwas Unfassbarem sein kann.
Chantals lange Fingernägel klackern auf dem Display ihres Handys. Nicht etwa, weil sie etwas eingibt – sie tippt ungeduldig auf dem Mobiltelefon herum. Essen aus der Mikrowelle schön und gut, aber die Wartezeit ist echt nervig. Okay, es geht schneller und einfacher als normales Kochen, aber… Es nervt.
Die Mikrowelle ist von ihrer Ungeduld unbeeindruckt, natürlich. Seelenruhig dreht der Inhalt seine Runden und ein Blick auf die Zeitanzeige verrät Chantal, dass sie noch ein Weilchen warten muss. Okay, wenn das so ist… Wieder klicken ihre Finger auf dem Display. Mal sehen, was ihr Handy an Abwechslung zu bieten hat. Instagram… Nichts, da hat sich in den letzten dreißig Sekunden – seit sie das letzte Mal nachgesehen hat – nichts getan. Auch keine neuen Nachrichten. Facebook… Ah, ein süßes Video. Immerhin etwas.
Als das Video vorbei ist, rattert ihre Mikrowelle weiter vor sich hin. „Boah ey…“ Genervt streicht sich Chantal eine Haarsträhne hinter das Ohr, wieder sieht sie sich die Zeitanzeige an. Gleich ist ihr Essen fertig, endlich. Nur noch ein paar Sekündchen… So viele Sekündchen, dass sie erneut die Runde durch ihre Apps schafft, bis endlich das Pling der Mikrowelle ertönt. Nun lässt Chantal sich nicht mehr aufhalten. Umgehend öffnet sie die Türe, greift vorsichtig nach ihrer Schüssel und hebt sie heraus.
Kaum hat sie die Schüssel abgestellt, hebt sie den Deckel ab und lässt den Dampf entweichen. Riecht schon ziemlich gut… Doch dann fällt Chantal etwas auf, das sie erst einmal von der bevorstehenden Mahlzeit ablenkt. Der Dampf verschwindet nicht. Dort, wo sie den Deckel anhebt, wo der Dampf entweicht, formt sich eine Masse, die fast schon fest wirkt – die zumindest so geballt ist, dass sie deutlich zu sehen ist, gräulichweiß, mitten in der Luft, tropfenförmig. Chantal erstarrt, sie blickt fassungslos auf diese merkwürdige Wolke und versucht zu begreifen, was genau sie da sieht. Dann entsteht ein kleiner Riss in der Wolke, er bewegt sich und…
„Hallo.“ Die Starre löst sich auf einen Schlag. Chantal lässt den Deckel fallen, sie schreit. Sie schreit und übertönt damit fast einen viel, viel leiseren, aber genauso entsetzten, wenn auch eher empörten Schrei. Intuitiv weicht Chantal zurück, Schritt für Schritt, bis sie mit dem Rücken an den Küchenschrank stößt. Hilfesuchend presst sie sich dagegen, ihr Blick ist immer noch fest auf ihr Essen gerichtet – und auf die Wolke, die sich langsam aufrappelt.
Kann sich eine Wolke aufrappeln? Diese Wolke schon – denn genau das ist es, was sie tut. Sie erhebt sich langsam, wackelt ein bisschen, bekommt wieder diese Tropfenform. Und wieder entsteht der Riss, der ein bisschen wie ein Mund aussieht – und zwei weitere darüber, zwei Augen, zwei Augen, die sie sehr wütend anfunkeln. Die Worte purzeln aus ihrem Mund, ohne dass sie darüber nachdenken kann. „Was bist du?“
Für einen kurzen Moment hofft sie, dass das alles nur eine Einbildung ist. Dass sie ihr Essen schlichtweg zu lange in der Mikrowelle gelassen hat und es dadurch so heiß wurde, dass ziemlich viel Dampf entstand, der nun auf einem Schlag entwichen ist. Dass sie sich das „Hallo“ gerade eben nur eingebildet hat oder es aus ihrem Handy kam oder so etwas. Doch sie wird enttäuscht. Wieder hört sie das leise Stimmchen.
„Ziemlich sauer und das zu recht, wenn du mich fragst, Püppchen.“ Die Angst wird ein bisschen weniger, dafür steigt nun Empörung in ihr auf. Wie hat dieser Rauchfetzen sie gerade genannt? „Ey, ich bin kein Püppchen.“ „Na klar, und ich bin Brad Pitt.“ „Ja, was bist du denn jetzt?“ Blind tastet Chantal am Küchenschrank entlang. Sie will nicht den Blick vom Dampf nehmen, aber sie will sich bewaffnen. Als sich ihre Finger um einen Kochlöffel schließen, wird sie etwas entspannter.
„Komm mal näher, Mädchen. Ich will nicht die ganze Zeit so schreien.“ Schreien ist das also? Am liebsten würde Chantal sich darüber lustig machen, dass dieses Wesen sein Wispern als ‚Schreien‘ bezeichnet, aber schon das bisschen, was er von sich gegeben hat, reicht, um zu erkennen, dass er das nicht gut aufnehmen würde. Und sie will nun einmal endlich wissen, mit was sie es da zu tun hat. Der Griff um ihren Kochlöffel wird fester, sie macht ein paar Schritte auf die Ablage mit der Schüssel und dem Etwas zu.
Nun erkennt sie Konturen im Rauch, sieht, dass er tatsächlich so etwas wie ein Gesicht hat und dass dieses aus mehr als dem Mund und den Augen besteht. Am liebsten würde sie ihn mit dem Kochlöffel anstupsen, doch wieder hält sie die Erkenntnis, dass er das nicht gutheißen würde, davon ab. „Okay, jetzt bin ich da. Also?“ „Sag‘ ‚bitte‘.“ Chantal verdreht die Augen, erneut zieht sie in Betracht, dieses aufmüpfige Wesen einfach zu pieksen. „Was bist du, bitte?“
Die Mundwinkel – die Enden des großen Risses – verziehen sich nach oben, das Wesen grinst sie an, ganz eindeutig. Es ist unglaublich, wie viel Emotion man aus diesem bisschen Rauch herauslesen kann. „Ein Djinn.“ Chantals Stirn runzelt sich, sie denkt angestrengt nach. „Wie in diesem einen Film da? Peter Pan?“ „Alladin.“ „Ja, oder so. War der nicht viel größer und… muskulöser und so?“ Als würde ein Windhauch ihn hin und her treiben, bewegt sich der Geist umher.
Sieht ganz niedlich aus, auch wenn seine Antwort darauf schließen lässt, dass es eher bedrohlich wirken sollte. „Meine Größe reicht völlig, um meine Aufgaben zu erledigen. Und wenn du dich nicht zusammenreißt, verschwinde ich.“ „Darfst du das?“ „Nein. Leider nicht.“ Okay, das Wesen ist mal wieder wütend. Und auch wenn Chantal nun weiß, dass er sie ertragen muss, egal wie schlimm sie zu ihm ist, beschließt sie, von dem Thema abzulassen.
Ganz offensichtlich hat ihr Djinn ein Problem damit, mit seinen besser gebauten Kollegen verglichen zu werden. „Okay, deine Aufgaben… Erfüllst du Wünsche?“ Das Männchen verschränkt die Arme vor der Brust und Chantal ist sich ziemlich sicher, dass er die Augen verdreht – auch wenn sie nicht weiß, wie sie darauf kommt. Also bitte, er sollte ihr dankbar dafür sein, dass sie nicht weiter nachgebohrt hat, warum er so winzig ist. „Ja. Du hast drei Wünsche frei.“
Sie nimmt keine Rücksicht auf seine Genervtheit. Stattdessen hellt sich ihr Blick auf, sie kommt noch ein Stück näher. „Ich darf mir wünschen, was ich will?“ „Nicht ganz. Du darfst dir keine weiteren Wünsche oder unendlich viele Wünsche wünschen.“ Wieder kommt die Runzelstirn zum Einsatz, wieder denkt Chantal nach. „Also, wenn ich mir jetzt schöne Augenbrauen wünsche, dann habe ich die?“ Auch diesmal ist sie sich sicher, dass das Wesen – der Djinn – die Augen verdreht.
Am liebsten würde sie ihm gegen den Kopf schnipsen, dem arroganten kleinen Kerl. Aber wenn er ihr Wünsche erfüllen kann… Wäre echt lustig, sich zu wünschen, dass er nett zu ihr sein soll. Da würde er wahrscheinlich platzen. „Genau.“ „Okay, dann… Wünsche ich mir schöne Augenbrauen.“ Kurz murmelt das Männchen etwas vor sich hin, was verdächtig nach ‚Verschwendung‘ klingt, dann reibt es seine kleinen Händchen aneinander und schwingt hin und her.
Diesmal sieht es nicht nach einem Windstoß aus, sondern gewollt – fast, als würde es auf einer Hängematte sitzen. Als er die Hände auseinander nimmt und in die Seiten stemmt, muss er gar nichts mehr sagen. Chantal zieht sofort ihr Handy heraus, um die Frontkamera zu aktivieren. Kurz darauf quiekt sie. „Oh mein Gott, das hat ja tatsächlich geklappt!“ „Natürlich hat es geklappt. Es ist mein Job, Wünsche zu erfüllen.“
Sie hört ihm nicht zu – lieber überlegt sie, was sie sich noch wünschen könnte. Einen vollen Kleiderschrank? Mh, wer weiß, was er dann hineinlegt. Einen vollen Geldbeutel, damit sie nachher, wenn sie mit ihrer besten Freundin Marie shoppen geht, kaufen kann, was sie will? Ja, schon eher. Oder… „Ich wünsche mir, dass meine Nagellackflaschen immer voll sind!“ Diesmal lässt sich der Djinn gar nichts mehr anmerken.
Er geht sofort dazu über, seine Hände zu reiben und sich hin und her zu wiegen. Dann hält er inne und sieht sie herausfordernd an. „Fertig.“ Gut, das nimmt sie jetzt so hin – wenn er das mit den Augenbrauen geschafft hat, wird auch das mit dem Nagellack geklappt haben, das muss sie nicht extra überprüfen. Es ist also Zeit für… „Jetzt habe ich noch einen Wunsch frei, oder?“ „Korrekt. Und du darfst dir keine weiteren Wünsche wünschen.“
Was soll sie dann nehmen? Quasi die ganze Welt steht ihr offen, aber sie muss sich jetzt entscheiden. Das spöttische Stimmchen des Männchens unterbricht ihre Gedanken. „Was darf es sein? Eine Brustvergrößerung? Oder doch lieber die Lippen?“ Dieses Mal ist es nur noch die Sorge davor, was passieren würde, wenn sie diesen frechen Zwerg berührt, die sie davon abhält, ihn zu schlagen. „Habe ich das etwa nötig?“ „Natürlich nicht.“
So, nun muss sie sich aber konzentrieren, egal, was der Djinn sagt oder tut. Und plötzlich hat sie den perfekten Wunsch. Sie grinst – das Grinsen wird umgehend vom Djinn erwidert. „Ich wünsche mir, dass es für alle meine Probleme und Sorgen ganz einfache, schnelle Lösungen gibt, jetzt und in der Zukunft.“ Das Lächeln des Djinns verblasst, er seufzt. Es klingt ein bisschen wie ein Mausepups, findet Chantal, doch das kann sie ihm nicht sagen, weil er schon spricht.
„Also Brustvergrößerung und Lippenvergrößerung. Raffiniert.“ „Und Weltfrieden. Und das neue Auto für meine Mutter.“ Nun ist das Grinsen endgültig verschwunden, der Djinn sieht sie fassungslos an. „Aber das…“ „Das entspricht den Regeln. Ich wünsche mir nicht, dass alles, was ich mir wünsche, passiert, sondern dass alles, was ich brauche, passiert.“ „Aber…“
Mehr hört sie vom Djinn nicht. Es gibt ein leises Plopp, wie ein Korken, der aus einer Flasche gezogen wird – und dann ist er weg. Die kleine Rauchfahne ist einfach verschwunden, übrig ist nur noch ganz normaler, gesichtsloser Dampf, der von ihrem Essen aufsteigt.
Das war alles? Chantal zuckt mit den Schultern, dann greift sie nach einer Gabel und probiert von ihrem Essen. Es hat genau die richtige Temperatur, nicht zu warm, nicht zu kalt. Also nimmt sie die Schüssel mit und nimmt damit am Küchentisch Platz.
Von dort aus kann sie in den Garten blicken. Der Himmel ist strahlend blau, von den dicken Gewitterwolken, wegen denen Chantal Sorge um ihre Frisur hatte, ist nichts mehr zu sehen. Chantal grinst immer noch.
Drei Wünsche und ein Kochlöffel Weiterlesen »